|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
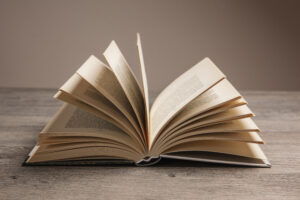
Rezension zu: Ulrike Schildmann (2024): Arbeiterkind und Professorin. Eine Biographie. Bochum: Projektverlag. ISBN 978-3-89733-614-8
Wer sich mit der Pädagogik für Menschen mit Behinderung oder der Integrations- und Inklusionspädagogik befasst, kommt an Ulrike Schildmann nicht vorbei. An der Technischen Universität Dortmund hat sie sich von 1996 bis 2014 mit der Frauenforschung in Rehabilitation und Pädagogik befasst.
Nun hat sie 2024 mit 74 Jahren eine Biographie, ihre Biographie, vorgelegt. Und diese Biographie besteht aus drei Teilen:
- Arbeiterkind und Professorin: Wie ich zu der Person geworden bin, als die ich mich heute verstehe
- Beziehungsmuster in Familie, Freundschaft, Nachbarschaft: Drei Briefe
- Die Welt erfahren und erleben
Berechtigterweise ist bei diesem Titel die Frage zum Thema Hirnverletzung zu stellen. Hiermit hat die Autorin aber selbst Erfahrungen im Status einer Angehörigen gemacht, denn:
- als Ulrike Schildmann 13 Jahre alt war, erlitt ihr Vater als Motorradfahrer einen schweren Verkehrsunfall. „Ein entgegenkommendes Fahrzeug gerät außer Kontrolle und erfasste ihn“ (S. 21). Daraufhin erfolgte die stationäre Behandlung für ein Jahr. Und – „das ist ein großer Einschnitt in unser Familienleben, alles gerät durcheinander“ (ebd.).
- als die Verfasserin 17 Jahre alt war, verunglückten ihre Schwester und deren Freund bei einem Verkehrsunfall schwer.
Diese Ereignisse waren für den Berufswunsch von Ulrike Schildmann verantwortlich. Hierbei handelte es sich um die Arbeit mit Menschen in außergewöhnlichen Lebenslagen, konkret die Themen Krankheit und Behinderung. Sie studierte Diplom-Pädagogik, wollte aber keine Lehrerin werden. Während dieses Studiums – und das resultiert aus den oben genannten Erfahrungen – hat sie sich mit der Körperbehindertenpädagogik intensiver auseinandergesetzt. Ihre Diplomarbeit verfasst Ulrike Schildmann 1976. Hier befasst sie sich kritisch mit der beruflichen Rehabilitation in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin. 1982 wurde die Verfasserin mit einer Arbeit zu weiblichen Lebenszusammenhängen und Behinderung vom Promotionsausschuss Dr. phil. an der Universität Bremen promoviert. 1995 habilitiert sie sich an der Technischen Universität mit einem Vergleich der Integrationspädagogik und dem Normalisierungsprinzip.
Mich beeindruckt der Werdegang von Ulrike Schildmann. Er ist nicht geradlinig, mit Höhen und Tiefen versehen und manchmal unsicher. Es ist ein Werdegang, den in ähnlicher Weise auch die Menschen erleben, die vor Abschluss ihrer Berufsausbildung ein hirntraumatisches Ereignis erfahren. Diese Erfahrung musste auch der Rezensent machen. Sicher ist dieser Werdegang nicht ganz so kritisch, wie es der Werdegang nach einer Hirnverletzung ist, da bei Ulrike Schildmann selbst keine Behinderungserfahrung vorliegt. Aber die Verkehrsunfälle, die sie bei ihren Angehörigen miterlebt hat, lassen eine Sensibilität für das Thema Krankheit und Behinderung erkennen.
Aus diesem Grund bin ich froh Ulrike Schildmann – ich glaube es war 1996 – in der Universität Dortmund kennengelernt zu haben. Auch wenn ich bis zum Lesen ihrer Biographie von den Schicksalsschlägen nichts wusste, erklärt sich mir nun ihre Zugewandtheit mir gegenüber, der ich seit 1982 mit den Folgen einer schweren Hirnverletzung lebe. Dieses soziale Engagement ist wohl auch in ihrer mittelbaren Betroffenheit begründet. Beim Warten auf den Zug nach Görlitz, wo an der dortigen Hochschule 2005 die 42. Arbeitstagung der Dozentinnen und Dozenten der Sonderpädagogik stattgefunden hat, haben die Verfasserin und der Rezensent am Bahnhof Cottbus ihre kollegiale Freundschaft beschlossen.
Diese Biographie kann Menschen, die beispielsweise nach einer schweren Hirnverletzung – nur noch – in prekären Verhältnissen leben, Mut zum Abstrampeln machen. Auch wenn zunächst alles sinn- und hoffnungslos erscheint, soll gerade die Hoffnung, die sprichwörtlich zuletzt stirbt, nicht aufgegeben werden.
Professor Dr. Carsten Rensinghoff
